
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind von Morbus Bechterew – axSpA betroffen. Dies ist eine chronische entzündliche Erkrankung, die Schmerzen und Steifheit im unteren Rücken, in der Hüfte und im Gesäss verursacht. Im Gegensatz zu anderen Arten von Rückenschmerzen bessern sich die Schmerzen und die Steifheit bei Bewegung und werden bei Ruhe schlimmer. Das Ziel des Welt-Bechterew-Tages ist es, die Aufmerksamkeit auf diese Krankheit zu lenken und zu verdeutlichen, welche Auswirkungen sie auf das Leben der betroffenen Personen hat – körperlich, geistig und seelisch.
Wenn das Binden der Schnürsenkel zur Herausforderung wird
Das Motto des diesjährigen Welt-Bechterew-Tags lautet «Lace Up for axSpA» (Schnürsenkel binden für axSpA) und ermutigt sowohl zum Bewusstsein als auch zum Handeln. Das Bild der Schnürsenkel symbolisiert die aktive Anstrengung, die notwendig ist, um zu verstehen, wie es ist, mit Morbus Bechterew – axSpA zu leben. Es veranschaulicht die täglichen Herausforderungen, denen sich Bechterew-Betroffene stellen müssen. Selbst eine scheinbar so einfache Aufgabe wie das Binden von Schnürsenkeln kann für Menschen, die unter den Schmerzen und der eingeschränkten Mobilität im Zusammenhang mit dieser Erkrankung leiden, zu einer unüberwindbaren Hürde werden. Durch die Konzentration auf diese nachvollziehbare Handlung soll zu einem besseren Verständnis für die Realitäten des Lebens mit Morbus Bechterew – axSpA eingeladen und gleichzeitig zu kollektiven Bemühungen um eine bessere Aufklärung und Unterstützung inspiriert werden.
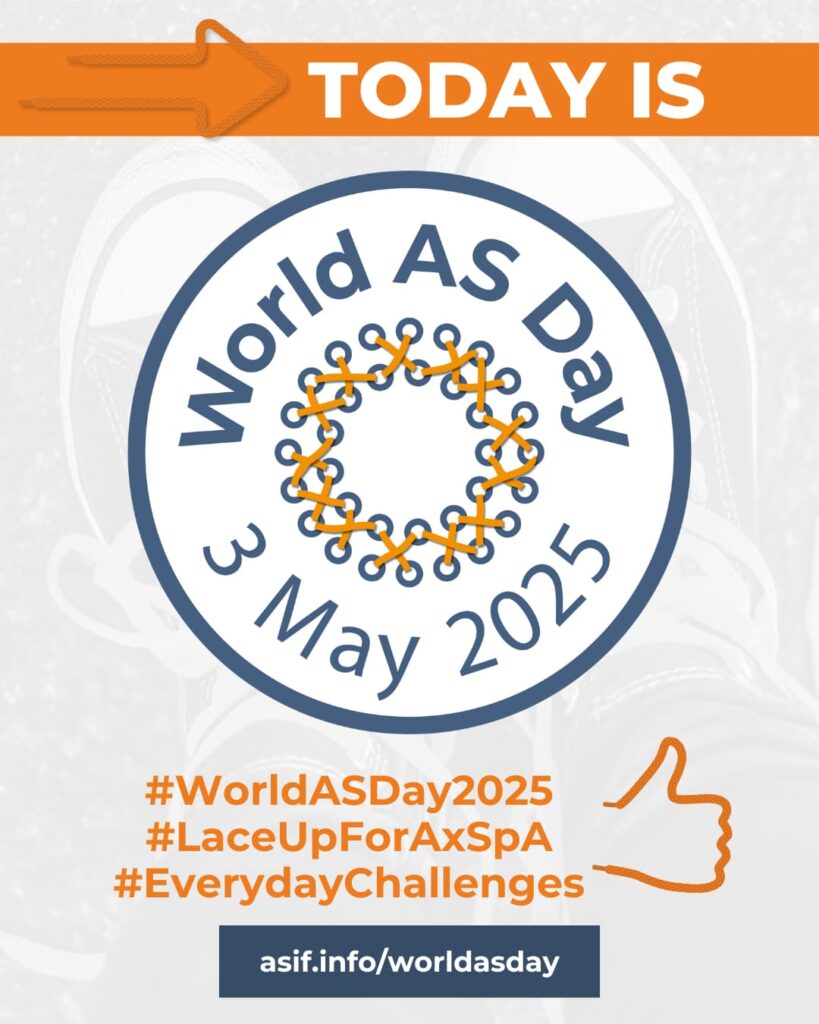
Aktionen rund um den Welt-Bechterew-Tag
Rund um den Welt-Bechterew-Tag finden unter anderem folgende Aktionen statt:
- Die Amerikanische Bechterew-Vereinigung organisiert auch dieses Jahr wiederum den «Global Spondyloarthritis Summit», einen virtuellen Kongress, an dem sich Fachpersonen und Betroffene aus der ganzen Welt zu aktuellen Themen rund um den Bechterew austauschen können. Unter dem Motto «Comorbidities: A Whole-Body Approach to Spondyloarthritis Care» (Komorbiditäten: Ein Ganzkörperansatz für die Behandlung der Spondyloarthritis) konzentrieren sich am 2. und 3. Mai zwölf Expertinnen und Experten aus der internationalen Gemeinschaft auf Morbus Bechterew – axSpA und mögliche Begleiterkrankungen. Details zu dieser Veranstaltung sind hier zu finden: spondyloarthritissummit2025.vfairs.com
- Dieses Jahr wird auch die Veranstaltung «Walk Your AS Off» fortgesetzt. Es handelt sich um eine von der internationalen Bechterew-Vereinigung ASIF unterstützte virtuelle Veranstaltung, die dazu ermutigt, sich zu bewegen und das Bewusstsein für Morbus Bechterew – axSpA und verwandte Krankheiten zu stärken. Die Veranstaltung dauert während dem ganzen Monat Mai. Betroffene können sich einzeln oder als Gruppe zum gemeinsamen Spazieren, Laufen oder Wandern anmelden. Mehr dazu erfahren Sie hier: spondylitis.org/walk-your-as-off
Weitere Informationen unter asif.info/worldasday
Wandern ist für viele Menschen mit Morbus Bechterew – axSpA weit mehr als nur eine Freizeitaktivität – es kann ein Schlüssel zu mehr Beweglichkeit, Wohlbefinden und Lebensqualität sein. Während einige Betroffene bereits regelmässig auf Wanderwegen unterwegs sind, fragen sich andere, ob und wie sie diesen Sport für sich entdecken können. Doch was macht das Wandern für Menschen mit axSpA so besonders? Welche Hürden gibt es, und wie lassen sie sich überwinden? Wir geben Einblicke, Inspiration und wertvolle Tipps für alle, die überlegen, sich auf den Weg zu machen.
(mehr …)Entspannungsübungen
Progressive Muskelrelaxation
Bei der Progressiven Muskelrelaxation (PMR) richtet die übende Person ihre Aufmerksamkeit auf den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung einzelner Muskelgruppen und spürt dabei intensiv die verschiedenen Zustände. Diese Übung dauert ca. 15 Minuten.
Guided Imagery
Bei der Guided Imagery (geleitete Imagination) fokussiert die übende Person in Gedanken auf angenehme, positive Bilder, die in der Übung angeleitet werden. Die geleitete Imagination kann helfen, einen entspannten Zustand zu erreichen, Stress zu reduzieren und ein Gefühl des Wohlbefindens zu vermitteln. Diese Übung dauert ca. 15 Minuten.
Achtsamkeitsübungen
Body Scan
Beim Body Scan wird die übende Person über eine längere Zeit (ca. 40 min) dabei angeleitet, eine beobachtende Rolle einzunehmen und die Empfindungen in einzelnen Körperteilen wahrzunehmen. Das Erlebte sollte dabei beobachtet werden, ohne zu analysieren, zu beurteilen oder darauf zu reagieren.
Gehmeditation
Die Gehmeditation nutzt Bewegung als Element. Die übende Person richtet die Aufmerksamkeit auf das Gehen. Das Hineinspüren in die eigenen Füsse bei langsam ausgeführten Gehbewegungen soll helfen, die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen.
Kurzmeditation
Bei dieser Kurzmeditation legt die übende Person den Fokus auf das Beobachten der eigenen Atmung mit dem Ziel, dadurch mit den Gedanken zur Ruhe zu kommen. Diese Übung dauert ca. 5 Minuten.

Hier finden Sie geeignete Entspannungsübungen
–> digital-health-space.ch/entspannung
Hier finden Sie Übungen zum Achtsamen Selbstmitgefühl
–> zentrum-fur-achtsamkeit.ch/ressourcen
Dieser Artikel ist zuerst in der Zeitschrift «vertical» Nr. 103 erschienen.
Mehr zum Thema Entspannung:
- Grundlagen zu Bewegung und Entspannung: So sorgen Sie aktiv für Entspannung
- SVMB-Mitglied Lilian Nagy: «Jede Bewegung lässt sich in Entspannungstechnik umwandeln»
- Diese Entspannungs-, Meditations- und Bewegungsmethoden empfiehlt eine Komplementärtherapeutin Bechterew-Betroffenen

Es ist ein gewöhnlicher Tag im August 2017. Der leidenschaftliche Läufer Mike Paroz (38) aus Sonceboz im Berner Jura nimmt an einem Wettkampf teil, als plötzlich sein Herz für 17 Minuten aufhört zu schlagen. Was für viele das Ende bedeutet hätte, markierte für Mike jedoch den Anfang eines neuen Kapitels in seinem Leben.
«Es war wie eine zweite Chance», sagt er. Ein Herzstillstand hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Doch er hatte Glück im Unglück. «Es hätte überall passieren können, aber zum Glück ist es dort passiert, wo ich sofort Hilfe bekommen habe», reflektiert er. Nur durch das schnelle Eingreifen von Mitläufern, darunter zufällig anwesende Ärzte, konnte sein Leben gerettet werden. «Sie gaben mir eine Herzmassage, bis der Krankenwagen kam und mich schockte», berichtet Mike. Ein Helikopter brachte ihn ins Krankenhaus, wo eine Notoperation an seinem Herz durchgeführt wurde, um eine koronare Arterie zu befreien, die von seinen Brustmuskeln eingeklemmt war. Seitdem hat sich vieles in seinem Leben verändert. Im Podcast «Au-delà du mur» (Informationen am Ende des Artikels) teilt Mike seine Geschichte und erzählt von seiner Kindheit im Jura, seiner Liebe zur Natur und wie er zum Laufen fand. Seine Erzählungen sind eine Mischung aus nostalgischen Erinnerungen und der harten Realität des Lebens mit einer chronischen Erkrankung. Doch er ist nicht nur ein leidenschaftlicher Läufer, der nach einem Herzstillstand ein zweites Leben geschenkt bekommen hat.
Neben dem Herzstillstand kämpft Mike Paroz auch gegen Morbus Bechterew. «Diese Krankheit hat mein Leben sehr beeinflusst», erzählt er. Schon im Jugendalter, während seiner Ausbildung, machten sich die ersten Symptome bemerkbar. «Die Ärzte brauchten lange, um die richtige Diagnose zu stellen», erinnert er sich. Die Krankheit verursacht schmerzhafte Entzündungen, die oft in den Beinen auftreten und das Gehen unmöglich machen können. Mike hat gelernt, mit der Krankheit zu leben. Anfangs nahm er viele Medikamente, später halfen ihm Biologika, die Entzündungen unter Kontrolle zu halten. «Jetzt nehme ich Medikamente nach Bedarf, und das ermöglicht es mir, weiterhin Sport zu treiben», erklärt er.
Sport als Ventil und Therapie
Der Sport spielt eine zentrale Rolle in Mikes Leben. «Laufen ist mein Ventil», sagt er. «Nachdem ich ganz unten war, habe ich mir geschworen, stärker zurückzukommen.» Und das hat er. Sport gibt ihm nicht nur physische Stärke zurück, sondern auch mentale Kraft. «Selbst wenn man eine Krankheit oder einen Unfall hatte, sollte man sich nicht aufgeben. Man muss kämpfen und vorwärtsgehen.» Sein Weg zum Laufsport begann schon in der Jugend. «Schon als Kind habe ich viel Zeit draussen verbracht und bin oft mit meinem Vater in den Wald gegangen», erinnert sich Mike. Sein Vater arbeitete mit Holz, und Mike liebte es, ihm dabei zu helfen. Diese frühen Erfahrungen in der Natur und die gemeinsamen Aktivitäten mit seiner Familie prägten ihn tief.
Später spielte er Fussball, bis er in seinen Zwanzigern die Freude am Laufen entdeckte. «Das Laufen war befreiend für mich», sagt er. «Es war etwas, das ich für mich selbst tat, um mich selbst zu finden.» Lange Zeit lief er ohne einen festen Trainingsplan, liess sich von seinem Gefühl leiten und nahm an Wettkämpfen teil, wann immer es ihm möglich war. «Ich hatte nie einen Trainer und habe mir auch keine Ratschläge geholt. Ich habe einfach gemacht, was sich richtig anfühlte», erzählt er.
Herzstillstand einige Tage vor der Hochzeit
Ein weiterer wichtiger Aspekt in Mikes Leben ist seine Familie. «Meine Eltern waren immer für mich da», sagt er. Besonders sein Vater unterstützte ihn, indem er ihn zu den vielen Arztterminen begleitete. Diese Unterstützung gab ihm die Kraft, weiterzumachen. «Wenn man die Möglichkeit hat, sich zu erholen, sollte man diese Chance nutzen und sich nicht aufgeben», betont er. Heute ist Mike selbst verheiratet und Vater von vier Kindern. Trotz der Herausforderungen des Familienlebens findet er jeden Tag Zeit zum Laufen. «Das ist mein Ding», sagt er. Seine Frau weiss immer, wohin er geht, wenn er joggen geht – ein Sicherheitsnetz, das beruhigt. Die Unterstützung seiner Frau ist für Mike von unschätzbarem Wert. «Meine Frau steht voll hinter mir», erzählt er. «Wenn ich an einem Wettkampf teilnehmen möchte, sagt sie immer: ‹Geh und mach es.›»
«Ich sehe das Leben jetzt anders, besonders in Bezug auf meine Familie», erklärt er. Die Unterstützung seiner Frau, seiner Kinder und seiner nahen Angehörigen ist ihm wichtiger denn je. «Wir sind nichts ohne unsere Liebsten. Morgen kann alles vorbei sein, also müssen wir jeden Tag geniessen, als wäre es der letzte», fügt er hinzu. Diese Erfahrung hat ihm eine neue Perspektive gegeben: «Ich habe eine zweite Chance bekommen, und die will ich nicht vertun. Ich lebe jetzt intensiver.»
Die Erfahrung des Herzstillstands war ein Wendepunkt im Leben von Mike Paroz. Er musste sich nicht nur körperlich erholen, sondern auch mental mit den Folgen eines solchen Traumas auseinandersetzen. Seine Frau und seine Familie durchlebten eine schwere Zeit, besonders da sie sich auf eine bald darauf stattfindende Hochzeit vorbereiteten. «Wir hatten schon alles geplant. Dass ich einen Monat vor der Hochzeit beinahe gestorben bin, war hart für uns alle», erinnert sich Mike.

Momente kleiner Siege
Trotz seiner positiven Einstellung bleibt die Angst ein ständiger Begleiter. «Natürlich denke ich darüber nach, dass so etwas wieder passieren könnte», gibt Mike zu. Die Sorge, erneut einen Herzstillstand zu erleiden, begleitet ihn. Doch anstatt sich davon lähmen zu lassen, lässt er sich regelmässig von Ärzten durchchecken und bleibt körperlich aktiv. «Die Ärzte sagen mir, dass alles in Ordnung ist, und das motiviert mich, weiterzumachen.» Für Mike ist die Teilnahme an verschiedenen Laufwettbewerben immer ein Highlight. Besonders stolz ist er auf den «Vier-Schritte-Lauf». «Ich habe einen engen Freund gebeten, mit mir zu laufen. Als wir zu der Stelle kamen, wo ich meinen Herzstillstand hatte, hatte ich Flashbacks. Doch ich habe es bis zum Ende geschafft», erinnert er sich. Diese Momente sind für ihn wie kleine Siege, die ihm zeigen, dass er trotz allem weiterkommen kann. Mike hat gelernt, das Beste aus seiner Situation zu machen, und sieht sich selbst als Beispiel dafür, was möglich ist. «Ich nehme die Dinge nicht auf die leichte Schulter. Es war sehr hart für mich», gibt er zu. Doch er hat gelernt, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen und daran zu wachsen. «Warum sollte ich mich still hinlegen, wenn ich aufstehen und weitergehen kann?», fragt er rhetorisch. Mikes Geschichte ist eine inspirierende Erzählung über Mut, Durchhaltevermögen und den unermüdlichen Willen, das Leben in vollen Zügen zu geniessen, trotz aller Widrigkeiten. Für Menschen mit Morbus Bechterew und anderen chronischen Erkrankungen zeigt sein Beispiel, dass es immer einen Weg gibt, weiterzumachen und sich nicht von der Krankheit definieren zu lassen. Sein Lebensmotto ist einfach, aber kraftvoll: «Solange du auf den Beinen bist, geh weiter.»
Der Podcast mit Mike Paroz kann in der Episode «Coureur du dimanche 05/Mike Paroz – 17 minutes…» auf audeladumur.ch oder youtube.com/watch?v=P7I46VtHb5k angehört werden (auf Französisch). Der Podcast ist auch auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.
Dieser Artikel ist zuerst in der Zeitschrift «vertical» Nr. 103 erschienen.
Wie beim Morbus Bechterew sind bei der peripheren Spondyloarthritis häufig die umliegenden Sehnenansätze und das Sprunggelenk betroffen. Der Fuss ist gemeinsam mit dem Knie und der Hüfte ein wichtiger Teil für die Fortbewegung. Er trägt das gesamte Körpergewicht und muss sich ständig an wechselnde Bodenbeschaffenheiten anpassen. Um das zu bewältigen, hat sich eine korrekte Beinachse als wichtig herausgestellt. Diese beurteilen wir in der Physiotherapie beim Gehen, Absitzen und Aufstehen sowie beim Treppensteigen. Dabei gibt es verschiedene Beobachtungskriterien: dass bei diesen Tätigkeiten die Beine parallel bleiben, die Kniescheibe über die zweite Zehe zeigt oder das Hüft-, Knie- und Sprunggelenk in einer Linie bleiben. Eine korrekte Beinachse sorgt für eine ausgeglichene Belastung des Sprunggelenks und der umliegenden Sehnen. Es ist also wichtig, das ganze Bein beim Bewegen zu beobachten und nicht nur den Fuss.
Um das neue Bewegungsmuster zu integrieren, ist es sinnvoll, bei ausreichender Fussbeweglichkeit ein Fussmuskeltraining, kombiniert mit instabilen Unterlagen, durchzuführen. Dabei müssen die Füsse arbeiten, um die korrekte Beinachse einzuhalten. Gute Schuhe und entlastendes Training wie beim Velofahren oder Schwimmen runden die Therapie für das Sprunggelenk ab.
Da Bewegung im Alltag sehr individuell ist und Ihr Sohn sicher auch bestimmte Sportarten bevorzugt, ist es wichtig, neben den erwähnten allgemeinen Übungen ein individuelles Programm mit dem behandelnden Physiotherapeuten zu erstellen, das Ihren Sohn zum Dranbleiben motiviert und ihm Spass macht.
Martina Kaufmann, Physiotherapeutin, MSc, OMT
Dieser Beitrag stammt aus der Rubrik «Ratgeber» der Zeitschrift «vertical». Werden auch Sie Mitglied und erhalten Sie weitere wertvolle Tipps für den Umgang mit Morbus Bechterew.
In einer kürzlich veröffentlichten Studie wurde die Langzeitwirkung von TNF-Hemmern auf die Knochendichte (Bone Mineral Density, BMD) und das Auftreten von Wirbelfrakturen bei Patienten mit Morbus Bechterew – axSpA untersucht. Das Forscherteam verfolgte 126 Patienten über einen Zeitraum von acht Jahren, um zu ermitteln, wie sich die Behandlung auf die BMD und das Frakturrisiko auswirkt. Die Ergebnisse bieten insbesondere wichtige Erkenntnisse für die Langzeittherapie der Betroffenen.
Ein starker Rücken dank besserer Knochendichte?
Die Studie zeigte, dass die BMD im Bereich der Lendenwirbelsäule (LWS) bei den meisten Patienten deutlich anstieg, insbesondere in den ersten vier Jahren der Behandlung. Die BMD-Werte verbesserten sich im Durchschnitt um 8,9 % nach vier Jahren und um 7,2 % nach acht Jahren im Vergleich zum Ausgangswert. Diese Verbesserung ist deshalb so wichtig, da eine niedrige Knochendichte häufig mit einem höheren Risiko für Knochenbrüche verbunden ist.
Eine höhere Knochendichte hingegen reduziert das Risiko von Osteoporose und damit verbundenen Frakturen. Für die Betroffenen ist es deshalb eine sehr gute Nachricht, dass TNF-Hemmer nicht nur die Entzündung und die steifen Gelenke in Schach halten, sondern auch das Skelettsystem unterstützen.
Dennoch: Frakturen bleiben eine Sorge
Doch so erfreulich diese Zuwächse der Knochendichte unter TNF-Therapie auch sind, das Risiko für neue Wirbelfrakturen bleibt bestehen. In der achtjährigen Beobachtungszeit entwickelten 16 % der Patienten neue Frakturen, und bei 6 % verschlimmerten sich bereits vorhandene Brüche. Diese Zahlen sind ein klares Signal dafür, dass die Verbesserung der Knochendichte allein nicht alle Probleme löst.
Besonders bei jenen, die bereits lange mit der Krankheit leben oder stark eingeschränkt in ihrer Mobilität sind, besteht weiterhin ein erhöhtes Risiko. Daher sollten Betroffene und ihre Ärzte die Knochengesundheit immer im Blick behalten und frühzeitig auf Anzeichen von Verschlechterungen reagieren.
Regelmässige Messungen empfehlenswert
Für Betroffene von Morbus Bechterew – axSpA ist die Langzeitbehandlung mit TNF-Hemmern eine gute Therapieoption, um sowohl die Krankheitsaktivität zu kontrollieren als auch die Knochendichte zu verbessern. Dennoch sollte das Risiko von Frakturen weiterhin aufmerksam überwacht werden. Es wird empfohlen, regelmässige Knochendichtemessungen und Wirbelsäulenröntgenaufnahmen durchzuführen, um mögliche Frakturen frühzeitig zu erkennen und entsprechende präventive Massnahmen zu ergreifen.
Die Studie verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit einer umfassenden Behandlungsstrategie, die neben der medikamentösen Therapie auch präventive Massnahmen zur Erhaltung der Knochengesundheit bei Morbus Bechterew – axSpA berücksichtigen sollte. Die Kombination aus TNF-Hemmung und einer gezielten Überwachung des Knochenstatus kann langfristig dazu beitragen, das Risiko schmerzhafter und behindernder Frakturen zu minimieren.
Siderius, Mark et al.: «Improvement of bone mineral density and new vertebral fractures during 8 years of TNF-α inhibition in patients with axial spondyloarthritis.» Seminars in Arthritis and Rheumatism. Vol. 68. WB Saunders, 2024.
Dieser Artikel ist zuerst in der Zeitschrift «vertical» Nr. 103 erschienen.
Die rheumatische Erkrankung Morbus Bechterew verläuft chronisch. Medikamente und Gymnastik helfen gegen das Fortschreiten, sagt der Rheumatologe Alexander Iseli.
Online-Version des Artikels ansehen
Am 18. Januar 2025 wurde auf SRF 1 die bekannte TV-Sendung «Gesundheit heute» zu Morbus Bechterew – axSpA ausgestrahlt. Dies unter Beteiligung der SVMB und ihres Mitglieds Erhan Ibraimi, der in einem Beitrag porträtiert wurde und im Fernsehstudio die Fragen der Moderatorin Dr. Jeanne Fürst beantwortete. Der beratende Arzt der SVMB, MPH PD Dr. med. Raphael Micheroli, stand ebenfalls für Fragen zur Verfügung.
Was bedeutet eigentlich Komplementärmedizin? Am einfachsten gesagt, heisst es, dass die Methoden aus diesem Bereich die Schulmedizin ergänzen oder eben komplettieren. Seit in der Schweiz über dieses Thema abgestimmt wurde, werden gewisse Methoden der Komplementärmedizin unter Erfüllung von Bedingungen auch von der Krankenkasse übernommen. Das ist weltweit einzigartig und zeigt, dass der Bevölkerung hierzulande eine ganzheitliche Sicht auf die Gesundheit am Herzen liegt. Eine Einstellung, die auch viele Bechterew-Betroffene aus gutem Grund teilen. Oder wie es Lilian Nagy auf den Punkt bringt: «Der Schlüssel zu ganzheitlichem Wohlbefinden und im Umgang mit Schmerz ist im achtsamen Umgang mit sich selbst.»
Sie ist eine Expertin sowohl in der Sache ihrer eigenen Gesundheit wie auch in der Komplementärmedizin. Das SVMB-Mitglied aus Meilen am Zürichsee beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit den unterschiedlichsten Ansätzen und Methoden der Komplementärmedizin – von Bewegungslehren und körperlichen Methoden wie Tai-Chi und Shiatsu über verschiedene Formen der Meditation bis hin zu Achtsamkeits- und Entspannungstechniken. Sie ist heute selbstständig an ihrem Wohnort tätig und unterstützt zudem die Klinik Hohenegg, die sich ebenfalls in Meilen ZH befindet, bei verschiedenen Therapieangeboten.

Alle Türen offenhalten
Lilian Nagy weiss, wie viel passende Ansätze aus der Komplementärmedizin für Bechterew-Betroffene wert sein können. Nach 16 Jahren Fehldiagnosen erhielt sie 2013 schliesslich die Diagnose Bechterew mit peripherem Befall.
Wer von komplementärmedizinischen Methoden und Meditation liest, könnte vermuten, dass Betroffene wie Lilian Nagy nichts von schulmedizinischen Therapien und Medikamenten wissen wollen oder diese gar ablehnen. Der Weg in die Komplementärmedizin ist für Lilian Nagy aber keine Flucht, auch sie profitiert von den heute verfügbaren medikamentösen Therapien. «Da diese jedoch selten ganz ohne Nebenwirkungen kommen, sollte man beim Bechterew offen sein für alle Ansätze», sagt sie. «Denn man weiss nie, ob die Krankheit im nächsten Moment rechts oder links abbiegt.» Sie selbst erhielt ebenfalls viele unterschiedliche medikamentöse Therapien.
Beruf, Berufung und Therapie zugleich
Entspannungstechniken und Komplementärmedizin sind bei Lilian Nagy Beruf, Berufung und Therapie zugleich. War sie anfänglich noch als Gymnastiklehrerin tätig, war sie später verantwortlich für die Therapieangebote einer grossen Fitnesscenter-Kette und machte sich dann 1999 selbstständig. Heute kann sie ihren Klienten eine breite Auswahl an Methoden anbieten – und profitiert gleichzeitig selbst davon. «Es ist doch ideal, wenn Betroffene anderen Betroffenen mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung weiterhelfen können», so Lilian Nagy. Ab und zu komme es vor, dass sie einen Patienten darauf hinweisen müsse, dass sie kein Wellness-Center betreibe. Alle Methoden bedürften auch des Einsatzes der Betroffenen.
Man merkt Lilian Nagy die Begeisterung und Überzeugung für die verschiedenen Methoden deutlich an. «Am meisten helfen mir persönlich Tai-Chi und meine 10’000 Schritte pro Tag», sagt sie. «Wenn ich diese zwei Dinge machen kann, geht es mir gut.» Bewegung müsse immer sein, auch bei «Hudelwetter». «Die Bewegung in der kühlen Luft ist gut für die Atmung und richtet mich ebenfalls auf. Und auch regelrechte Kältetherapie steht bei ihr auf dem Programm: Sie geht auch im Herbst und Winter im Zürichsee baden oder nimmt kalte Bäder.

Schon ein achtsamer Spaziergang kann helfen
Lilian Nagy kennt das Dilemma des Bechterews, der einen in Schubphasen daran hindert, einer körperlichen Aktivität nachzugehen. Denn auch sie hat Tage, an denen aufgrund der Erkrankung nichts mehr geht. «Dann ist es besonders wichtig, eine gute Balance zwischen der eigenen Gesundheit und den Verpflichtungen, zum Beispiel gegenüber seinen Klientinnen, zu finden.» Das seien die Tage, an denen man einfach funktioniere und sich durchbeissen müsse. Und sie ist sich auch bewusst, dass es unter Schmerzen schwierig sein kann, für eine Meditation längere Zeit still zu sitzen. Dann helfe ihr oftmals ein moderates Fitnesstraining. Und um in die Ruhe zu kommen, brauche es viel Zeit und Geduld. Sie selbst konnte diese über 25 Jahre auch in verschiedenen Weiterbildungen einüben. Sie ist überzeugt: «Unter Einhaltung einiger weniger Leitsätze kann man jegliche Form von Bewegung zu Entspannungsübungen umwandeln. Bereits das achtsame Gehen oder Spazieren kann so ein sehr hilfreiches Mittel sein, sich dem Schmerz und der Müdigkeit zu entziehen.» Und weiter: «Gehören die meditativen Aspekte wesentlich zur Bewegung, ist es eine ganzheitlich-integrative Methode. Wenn die Achtsamkeit gewissermassen als ‹Zugabe› zu einem traditionellen Training hinzukommt, ist sie es nicht. Bei einem traditionellen Training liegt der Fokus darin, ein Ziel zu erreichen – leider mitunter verbunden mit Schmerz, Ermüdung und Frust.»
Auch «Sitzen» ist eine Bewegung
Neben den körperlichen Methoden spielen für Lilian Nagy auch verschiedene Meditationsansätze eine wichtige Rolle im Umgang mit dem Bechterew. Sie praktiziert seit vielen Jahren Sitzmeditationen und hat eine Ausbildung zur Kontemplationslehrerin absolviert. Dazu kommen verschiedene weitere Meditationstechniken und Yoga-Methoden.
Auch das meditative Sitzen sei eine Bewegung – eine meditative Bewegung. Lilian Nagy empfiehlt, mindestens einmal täglich für wenige Minuten zu «sitzen». «Egal, welche Sportart oder Entspannungsübung man macht, während dem Meditieren verankert der Körper die Übungen im Geist, sodass das Training das nächste Mal leichter fällt.» Dabei gelte es ebenso, eine kleine Aufwärmübung zu erarbeiten, die einem das Sitzen angenehmer mache. «Für eine aufrechte Haltung ist es wichtig, den Beckenboden auszurichten, das Becken also weder nach vorne noch nach hinten zu schieben. Die Hände fallen locker auf die Oberschenkel oder liegen sanft auf dem Bauch.»
Wie bei allen sportlichen Betätigungen sei es auch bei meditativen Bewegungen oder der Meditation wichtig, Aufwärm- und Abschlussübungen zu machen und sich stets etwas Zeit zu nehmen, Körper und Geist auf die Herausforderungen einzustimmen. Auch die Rückkehr in den Alltag sollte vorbereitet werden und das Üben bzw. Trainieren sollte man langsam ausklingen lassen.
Als «Personal Training» sehen
Lilian Nagy empfiehlt anderen Betroffenen, das Erlernen von Entspannungstechniken wie den Beginn eines Trainings im Fitnesscenter anzugehen. Entsprechend dem «Personal Trainer», der einen im Fitnesscenter vor allem am Anfang begleitet, sollten auch Entspannungstechniken in einem Einzeltraining stattfinden. «Man sollte sich über eine längere Zeit von einer erfahrenen Therapeutin oder einem Therapeuten aus dem komplementär- oder alternativmedizinischen Bereich begleiten lassen.» Bei den meisten Fachpersonen sei auch eine Rückvergütung über eine Zusatzversicherung bei der Krankenkasse möglich.
Um das volle Potenzial von Entspannungstechniken nutzen zu können, sollten Bechterew-Betroffene vor allem auf eines achten: «Das Training sollte ihnen auch auf lange Sicht Freude machen.»
Dieser Artikel ist zuerst in der Zeitschrift «vertical» Nr. 103 erschienen.
Mehr zum Thema Entspannung:
- Grundlagen zu Bewegung und Entspannung: So sorgen Sie aktiv für Entspannung
- Diese Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen können beim Bechterew hilfreich sein
- Diese Entspannungs-, Meditations- und Bewegungsmethoden empfiehlt eine Komplementärtherapeutin Bechterew-Betroffenen
Auf den ersten Blick ist es ein Widerspruch: Bechterew und Entspannung, wie geht das zusammen? Morbus Bechterew – axSpA ist ja die Krankheit schlechthin, bei der man durch Aktivität, also insbesondere Bewegung und Sport, sowohl kurz- wie auch langfristig Verbesserungen erzielen kann. Es ist in diesem Fall alles andere als angezeigt, sich mit einem guten Buch aufs Sofa zu legen oder anderen Dingen nachzugehen, die man als entspannend wahrnimmt. Doch vielleicht kann Entspannung auch ganz anders aussehen. Viele Menschen suchen auch einen «aktiven» Ausgleich zu ihrem Alltag, indem sie zum Beispiel Sport treiben oder anderen Hobbys nachgehen. Dabei geht heutzutage leider oft vergessen, dass Momente und Phasen der Entspannung ganz entscheidend sind für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dies erst recht angesichts der zahlreichen herausfordernden Erfahrungen und Themen, die der Bechterew mit sich bringt.
Schmerzhafte Schübe, Bewegungseinschränkungen und die Sorge um die Zukunft sind allgegenwärtige Themen. Nicht selten fühlen sich Betroffene hilflos und gefangen in der Abwärtsspirale zwischen körperlichen und seelischen Belastungen. Hinzu kommen oft Fragen zum Thema Schmerzlinderung, Umgang mit Stress sowie der Wunsch, den Alltag besser zu bewältigen und ihre Lebensqualität zurückzugewinnen.
Aus dem Teufelskreis kommen
Es ist typisch für chronische Erkrankungen wie Morbus Bechterew – axSpA, dass körperliche und seelische Belastungen sich gegenseitig verstärken. Anhaltende Schmerzen und die eingeschränkte Beweglichkeit führen zu Stress und Anspannung, was wiederum die Schmerzen verstärken kann. Ein Weg, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, liegt darin, den Schmerz und die eigene Reaktion darauf bewusst wahrzunehmen, ohne ihn ständig zu bekämpfen. Dabei können Achtsamkeitsübungen und Körperwahrnehmungstechniken helfen, den Schmerz besser zu akzeptieren und in einen anderen Kontext zu stellen.
Nun denken Sie vielleicht: Soll ich also durch eine einfache geistige Übung meine Bechterew-Schmerzen zum Verschwinden bringen können? Wenn es doch nur so einfach wäre! Und natürlich haben Sie recht, dem ist leider nicht immer so. Die Ansätze der Entspannungstechniken und -methoden gehen aber in diese Richtung und können in jedem Fall eine wertvolle Unterstützung bieten, auf welche die Betroffenen nicht verzichten sollten.
Psychosomatische Ansätze zur Schmerzlinderung
Auch wenn man sich als Bechterew-Betroffene häufig nicht mehr als Herr über den eigenen Körper fühlt und diesen vielleicht manchmal am liebsten verlassen würde, ist es wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass der eigene Körper und Geist starke Hebel sind, die man selbst positiv beeinflussen kann. Und sie bilden eine enge Einheit. Was vielleicht etwas abgedroschen klingt, findet inzwischen auch in der Schulmedizin Beachtung. So gibt es zum Beispiel am Universitätsspital Zürich (USZ) das Institut für komplementäre und integrative Medizin, das sich mit der Schnittmenge aus körperlichen und geistigen Fragestellungen, der sogenannten Mind-Body-Medizin befasst. Damit sollen sowohl Betroffene von akuten gesundheitlichen Problemen wie auch solche von chronischen Erkrankungen unterstützt werden. Auch in der Rehabilitation spielen all diese Aspekte eine wichtige Rolle.
Psychosomatische Ansätze nutzen die enge Verbindung zwischen Geist und Körper, um Spannungen abzubauen und das Schmerzempfinden zu reduzieren. Techniken wie die Progressive Muskelrelaxation (PMR), das autogene Training und Yoga bieten eine wertvolle Ergänzung zu körperlichen Übungen. Gerade bei PMR oder autogenem Training lernen die Teilnehmenden, bewusst bestimmte Muskelgruppen anzuspannen und zu entspannen. Dadurch verbessert sich die Körperwahrnehmung, und oft gelingt es, muskuläre Anspannungen, die durch chronische Schmerzen entstehen, zu lösen. Betroffene berichten oft, dass sie durch regelmässiges Üben eine Form der inneren Distanzierung vom Schmerz empfinden und diesen weniger belastend wahrnehmen.

Neuer Trend «Mind-Body-Medizin»
Die Mind-Body-Medizin verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem ebenfalls die Verbindung zwischen Körper und Geist im Vordergrund steht. Zu den häufig genutzten Methoden zählen Yoga, Tai-Chi, Qigong sowie verschiedene Achtsamkeitstechniken. Ziel ist es, Körper und Geist in Einklang zu bringen, den inneren Stress zu reduzieren und somit auch auf den Krankheitsverlauf einen positiven Einfluss zu nehmen.
Auch die Forschung zur Psychosomatik und zur sogenannten Mind-Body-Medizin zeigt, dass durch integrative Ansätze eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden kann. Studien belegen, dass Achtsamkeitsübungen, Meditation und sanfte Bewegungstechniken Schmerzen verringern und Stress reduzieren können. Besonders die Anwendung von Achtsamkeitstraining und körperorientierter Psychotherapie hat sich als vielversprechend erwiesen. Sie beeinflussen das Schmerzempfinden und wirken stressreduzierend, was für Menschen mit Morbus Bechterew – axSpA von grossem Nutzen ist.
In Bewegung zur Ruhe kommen
Für Menschen mit Morbus Bechterew – axSpA ist Bewegung ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags, um die Gelenke geschmeidig zu halten und Schmerzen zu lindern. Deshalb führt bei ihnen oft genau diese Bewegung zu einer Entspannung. Und auch Entspannungstechniken sind nur auf den ersten Blick ein Widerspruch zur Bewegung. Tatsächlich lassen sich beide gut kombinieren. Methoden wie die Progressive Muskelrelaxation (PMR), das autogene Training oder die Bewegungsformen Yoga und Tai-Chi verbinden Bewegung mit ruhigen, achtsamen Phasen und fördern dabei sowohl die Flexibilität als auch die Entspannung. Diese Techniken haben zudem den Vorteil, dass sie in Kursen vermittelt werden und leicht zu erlernen sind. Sie erfordern kein umfangreiches Equipment und lassen sich auch im Alltag problemlos anwenden. Wichtig ist dabei, geduldig zu sein und die Technik nach und nach in den Tagesablauf zu integrieren. So kann mit kleinem Aufwand eine beachtliche Wirkung erzielt werden.
Auch die Kombination aus physiotherapeutischen Übungen der Online-Übungsplattform Rheumafit.ch oder des Kalenders «7-Tage-Programm für Menschen mit Morbus Bechterew» mit Entspannungstechniken kann sich in der Praxis als hilfreich zeigen. Zudem gibt es inzwischen verschiedene aktive Formen der Meditation, zum Beispiel Gehmeditationen, Bewegungsmeditationen oder sogar Tanzmeditationen, die ebenfalls eine hervorragende Möglichkeit bieten, in Bewegung zur Ruhe zu kommen. All diese Formen der Meditation sind besonders für Menschen mit Morbus Bechterew – axSpA geeignet, da sie Bewegung und Entspannung verbinden. Während klassische Meditation im Sitzen oft schwerfällt, sind aktive Formen eine ideale Möglichkeit, den Geist zu beruhigen und gleichzeitig den Körper in Bewegung zu halten.

Verschiedene Methoden ausprobieren
Wer Interesse an Entspannungsmethoden hat, sollte verschiedene Ansätze ausprobieren, um die passende Technik zu finden. Ein wichtiger Schritt zur Integration von Entspannungsmethoden in den Therapieplan ist die Erkenntnis, dass diese überhaupt erlernt werden und man damit einen Einfluss auf das eigene Wohlbefinden ausüben kann. Dieser Schritt kann als Teil der Therapie gesehen werden, weil man damit bereits in die Aktivität kommt und damit seinen eigenen Selbstwirksamkeitsglauben stärkt. Dieser ist ein Konzept aus der Psychologie, das besagt, dass der Glaube an die Wirksamkeit des eigenen Handelns ein wichtiger Baustein für die psychische Gesundheit ist. Und es ist etwas, das Bechterew-Betroffene auch bei der Bewegungstherapie erleben können. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen oder die Teilnahme an Seminaren und Veranstaltungen der SVMB bieten eine gute Orientierung, um herauszufinden, welche Methode den eigenen Bedürfnissen am besten entspricht. Bei der Wahl der passenden Methode sollten Betroffene auf Angebote seriöser Anbieter und anerkannte Methoden achten. Die SVMB empfiehlt ausschliesslich Methoden und Kurse, die auf wissenschaftlicher Grundlage beruhen und auf die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Morbus Bechterew – axSpA ausgerichtet sind. Durch diese Orientierung können Betroffene sicher sein, dass die Techniken von Fachleuten geleitet werden.
Kleine Schritte zur Routine machen
Entspannungstechniken sind keine Wunderheilmittel. Sie können zwar helfen, die Symptome von Morbus Bechterew – axSpA zu lindern, ersetzen aber keine medizinische Behandlung. Es ist wichtig, mit realistischen Erwartungen an diese Methoden heranzugehen und sich nicht zu viel Druck zu machen. Wer Techniken zur Entspannung in seinen Alltag integrieren möchte, sollte klein anfangen. Schon fünf Minuten tägliche Atemübungen oder Progressive Muskelentspannung können langfristig einen Unterschied machen und die Lebensqualität verbessern. Auch wenn es anfangs ungewohnt ist, regelmässiges Üben ist entscheidend für die Wirkung. Dabei helfen kleine Routinen, etwa die Übungen bewusst nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen zu integrieren. So können neue Verhaltensweisen gefestigt werden.
Während Achtsamkeitstraining viele Vorteile bietet, gibt es auch Hinweise darauf, dass intensive Praktiken bei manchen Menschen unerwünschte Wirkungen hervorrufen können, wie verstärkte innere Unruhe oder emotionale Überforderung. Eine aktuelle Studie untersuchte den Zusammenhang von Achtsamkeitstraining und Widerstandsfähigkeit gegen Stress bei 670 Studierenden. Alle Teilnehmenden erhielten psychologische Unterstützung zur Stressbewältigung. Ein Teil der Probanden erhielt zusätzlich ein acht Wochen dauerndes Achtsamkeitstraining. Nach einem Jahr nahmen alle Teilnehmenden an einer Online-Befragung teil, wobei sie auch Fragen zu Art und Häufigkeit von Veränderungen ihrer Bewusstseinszustände beantworten sollten. Diese traten in der Gruppe, welche das Achtsamkeitstraining absolviert hatte, doppelt so häufig auf. Und je intensiver dieses Training gewesen war, desto höher war die Wahrscheinlichkeit für veränderte Bewusstseinszustände. Die Studienautoren zeigen sich wenig überrascht über diese Resultate, da der Nutzen solcher Trainings für die geistige und die körperliche Gesundheit gut bekannt sei.
Natürliches High durch Achtsamkeit
Man könne fast von einem High-Gefühl sprechen, wie es beim Konsum psychoaktiver Substanzen auftreten kann. Da solche Gefühle für manche Menschen jedoch schwierig einzuordnen oder gar beängstigend sein können, sei es wichtig, sich beim Erlernen oder Ausüben eines solchen Trainings gut beraten und begleiten zu lassen. Seriöse Anbieter arbeiten oft mit psychologisch ausgebildeten Fachleuten zusammen, die auf eventuelle Nebenwirkungen vorbereitet sind.
Entspannung und Bewegung müssen sich bei Morbus Bechterew – axSpA also nicht ausschliessen, sondern können sich ergänzen. Menschen mit Morbus Bechterew, die Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken in ihren Alltag integrieren, berichten häufig von weniger Schmerzen und einer verbesserten psychischen Stabilität. Der Weg mag anfangs ungewohnt erscheinen, doch die positiven Effekte sind den Aufwand wert.
Übrigens: In der aktuell noch andauernden kalten Jahreszeit helfen vielen Betroffenen auch gezielte Wärmeanwendungen, um in die Entspannung zu kommen. Dies können zum Beispiel warme Wickel, eine Wärmeflasche, warme Bäder oder der Besuch von Thermalbädern oder Saunen sein. Was auch immer für Sie entspannend ist, pflegen Sie es aktiv und bleiben Sie dabei in Bewegung.
Dieser Artikel ist zuerst in der Zeitschrift «vertical» Nr. 103 erschienen.
Mehr zum Thema Entspannung:
- SVMB-Mitglied Lilian Nagy: «Jede Bewegung lässt sich in Entspannungstechnik umwandeln»
- Diese Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen können beim Bechterew hilfreich sein
- Diese Entspannungs-, Meditations- und Bewegungsmethoden empfiehlt eine Komplementärtherapeutin Bechterew-Betroffenen
